programmierung
und datenbanken
Joern Ploennigs
Datenhaltung
Ablauf¶
Wo liegen unsere Daten?¶
Smartphones und Tablets
Nutzung: Möglichst simpel bedienbare, fokussierte Anwendungen
Daten: Daten werden App-bezogen auf dem mitgelieferten Speicher gelagert
Desktop-PCs
Nutzung: Heutzutage meist als Arbeitsplatzrechner oder Hobby-Maschine
Daten: Daten liegen in Ordnerstrukturen, gespeichert auf lokalen Laufwerken
Web- und Cloudanwendungen
Nutzung: Überall von Apps bis zu Hochleistungsrechnen
Daten: Liegen in weltweit verteilten Serverfarmen, meist von großen Konzernen verwaltet
Hörsaalfrage¶
Aus welcher Hardware besteht ein Computer?
Wie vergleichen diese sich zum Gedächtnis des Menschen?
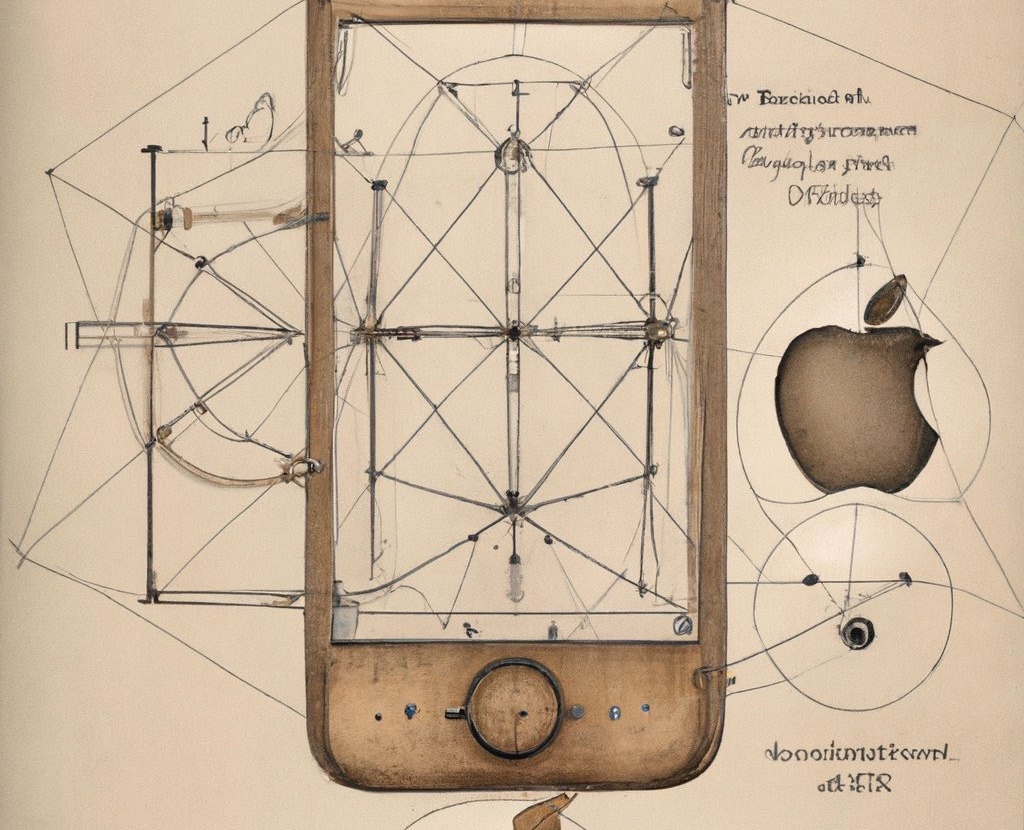
Einführung - Wo werden Daten im Computer abgelegt?¶
Der Computer hat ähnliche Gedächtnisarten wie der Mensch:
- CPU und GPU haben kleine Register und Cache Speicher (Ultra-Kurzzeitgedächtnis)
- Der RAM ist ein volatiler Speicher, d.h. der Inhalt geht beim ausschalten verloren (Kurzzeitgedächtnis)
- Die HDD/SSD ist ein permanenter Speicher, d.h. der Inhalt bleibt erhalten (Langzeitgedächtnis)
CPU Register & Cache - Speicherung auf Prozessorebene¶
Register – Der von der CPU zum Rechnen benutzte Speicher (sehr klein)
Cache – Hier werden Code und Daten vorausschauend geladen (Caching), die vmtl. gleich gebraucht werden oder welche woanders hin geschrieben werden sollen
Eigenschaften:
- Sehr schneller, prozessorinterner Speicher
- Teuer, extrem kleine Kapazität
- Muss möglichst in der selben Geschwindigkeit arbeiten wie das Rechenwerk um keinen Flaschenhals zu erzeugen
RAM - Random Access Memory¶
- Auch „Direktzugriffsspeicher" oder „Arbeitsspeicher"
- Schreib-Lese-Speicher, der nicht sequentiell gelesen werden muss, sondern in dem Daten direkt über ihre Adresse angesprochen werden können
- Diese Zugriffe sind schnell, Blöcke können effizient angesprochen werden
- Heutzutage meistens im Kontext von CPU-/GPU-nahem Arbeitsspeicher verwendet, d.h. es werden aktuell benötigte Daten verwaltet, welche verloren gehen wenn der Strom verloren geht
Wie werden Daten im RAM organisiert?¶
Die Speicherzellen im RAM sind in Blöcke mit Adressen eingeteilt
Das Betriebssystem weist jedem laufenden Programme so viele Blöcke wie dieses Programm braucht zu
Programme organisieren sich diese Blöcke in Stack und Heap:
- Stack enthält die Funktionsaufrufe und wichtige (einfache) Variablen
- Heap enthält alle anderen Variablen
Jede Variable im Code besteht aus:
- ein Verweis (Pointer) auf diese Adresse
- die Länge der Variable im Speicher (gegeben durch den Datentyp)
- bei Programmiersprachen mit Garbage Collection (Python, Java, JavaScript, etc.) gibt es für jede Variable noch einen Zähler wie oft die Variable verwendet wird
HDD/SSD – Hard Disk Drive / Solid State Drive¶
Hard Disk Drive (HDD)
Speicher auf dem Daten magnetisch abgespeichert werden
Können viele Jahre halten
Erschütterungsempfindlich
Solid State Drive (SSD)
Speicher auf dem Daten in elektrischen Ladungen abgespeichert werden
Können mehrere Jahre halten, entladen sich aber irgendwann
Zum Löschen wird ein Spannungssprung (Flash) benutzt → Flash-Speicher
Magnetbänder
Daten werden magnetisch auf Plastikbändern abgespeichert
Die Daten halten viele Jahrzehnte
Werden heutzutage noch für Backups benutzt
Preiswert, allerdings sehr langsam
Wie werden Daten in Langzeitspeichern organisiert?¶
- Die Speicherzellen in Langzeitspeichern sind auch in Blöcke mit Adressen eingeteilt
- Das Betriebssystem organisiert diese Blöcke und merkt sich welche Daten wo gespeichert werden (z.B. welche Blöcke zu welcher Datei gehören)
- Diese Organisationsstruktur nennt man Dateisystem
Dateisystem - Desktop-PCs: Dateien in Ordnerstrukturen¶
- Hierarchisch (wie bei der Büroablage) in Laufwerke (Register), Ordner & Dateien organisiert
- Daten werden in Dateien abgespeichert
- Diese werden in Ordnerhierarchien (Baumstruktur!) abgelegt
- Identifiziert werden sie durch Ordnerpfade und Namen
Vorteile:
- So können sehr viele Dateien organisiert werden
Nachteile:
- Wird sehr schnell unübersichtlich
- Programme können fast alles lesen
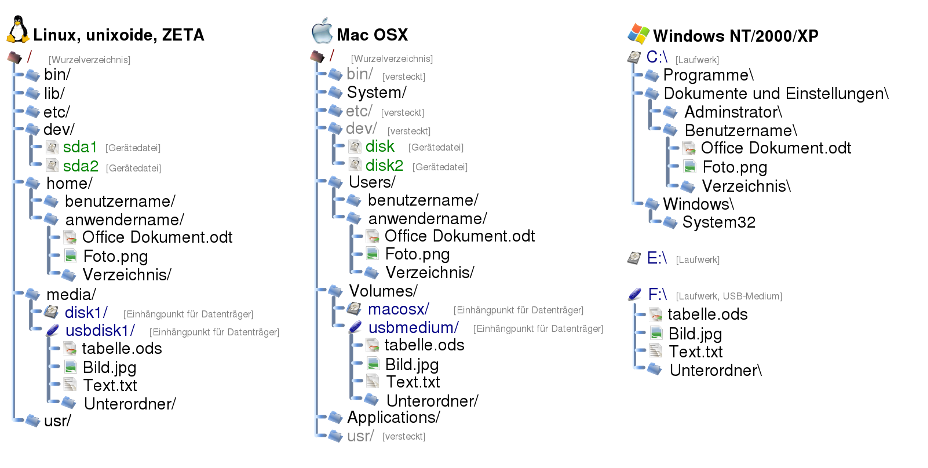
Dateisystem - Smartphones & Tablets: App-spezifische Speicherung¶
- Daten werden meist Apps zugeordnet (gekapselt)
- So sieht die App nicht das volle Dateisystem (und der Nutzer oft auch nicht)
- Dadurch kann die App weniger Unfug treiben und die Sicherheit wird verbessert
Vorteile:
Intuitivere Benutzung mit weniger Dateien pro App
Erhöhte Sicherheit
Nachteil:
Es ist schwierig Dateien zwischen Apps zu synchronisieren
Dateisystem - Cloud: Datenbanken¶
- Daten können nicht lokal gespeichert werden
- Werden meist nur in Datenbanken gespeichert → siehe nächste Vorlesung
Vorteile:
Programme und Daten sind physikalisch getrennt
Viele Programminstanzen können auf die gleichen Daten zugreifen
Beliebig hinzugefügt oder entfernt werden
Nachteil:
Schwerer zu konfigurieren und zu debuggen
Eine gewisse „Entmündigung"
Dateisystem - in Python¶
- Python verallgemeinert das Arbeiten mit Dateisystemen so weit wie möglich
- Viele verschiedene Funktionen und Bibliotheken!
os,io,open(),fileinput… - Verschiedene Abstraktionsgrade – von direkten String-basierten Leseoperationen bis hin zur hierarchischen, objektorientierten Repräsentationen ganzer Ordnerstrukturen
- Dateien werden selten „im Ganzen" ausgelesen (ineffizient bei großen Dateien), sondern Zeile für Zeile, Zeichen für Zeichen, oder auch selektiv z.B. durch ein Inhaltsverzeichnis
Dateiformate – Grobe Einteilung¶
Text
Die Datei ist ein großer String
Kann von Menschen und Software gelesen werden
Resultiert meist in größeren Dateien
Einfacher zu Debuggen da lesbar
Gut für strukturierte Inhalte (z.B. Text, Attribute, Statistiken)
Zusätzliche Struktur wird mittels Syntax-Regeln hinzugefügt (.csv, .json, …)
Binär
Die Datei ist ein Bytearray
Nur durch Software lesbar, nicht durch den Menschen
Resultiert in meist kleineren Dateien
Schwerer zu Debuggen da nicht lesbar
Gut für unstrukturierte und große Inhalte (z.B. um Bilder und Videos darzustellen)
Dateiendungen signalisieren mit welchem Programm Dateien verlinkt sind
Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 1: Geometrische Modell Formate¶
Vektor- und Rasterdaten definiert mit einem Koordinatensystem
Verschiedene Dimensionalitäten (2D, 2.5D, 3D, …)
Häufig genutzte Formate:
- 2D-Planungs-Formate: DWG, DXF, SVG, PDF, PNG, TIFF
- 3D-Planungs-Formate: IFC (STEP), IFC (XML), IFC (JSON), DWG, DXF, OBJ, 3DS
- Geodaten-Formate: Shapefile, GML (XML), KML (XML), GeoTIFF, GeoJSON (JSON)
Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 2: Attributformate¶
Deskriptive, nicht-geometrische Daten für spezifischen Kontext
Oft durch Tabellen oder Listen von Datenobjekten organisiert
Häufig genutzte Formate:
- CSV, ODF (XML), XLSX (XML), XLS, JSON
- Unterschiedliche Ebenen an Komplexität
Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 3: Geometrieformate¶
Geometrische Daten sind meist mathematisch und haben keinen klar definierten Weg
Grafikformate definieren solche „Stile", z.B. für Punkte, Linien, Polygone etc.
Häufig genutzte Formate:
- CSS, SLD (XML), ArcGIS Styles (*.lyr)
Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 4: Topologieformate¶
Geometrie durch Nachbarschaftsbeziehungen statt Koordinatensystemen
Knoten, Kanten, Maschen, Gitter
Häufig genutzte Formate:
- GML (XML), TopoJSON (JSON)
Austauschformate - JSON (JavaScript Object Notation)¶
- Menschen- und maschinenlesbares strukturiertes Datenformat
- Hauptsächlich als Austauschformat genutzt
- Realisiert durch Key-Value Paare (ähnlich wie Python Wörterbücher)
- Erlaubt die Abbildung aller Datentypen aus Python:
- Number
- String
- Boolean
- List
- Dict
- None (null)
{
"firstName": "John",
"lastName": "Smith",
"isAlive": true,
"age": 25,
"address": {
"streetAddress": "21 2nd Street",
"city": "New York",
"state": "NY",
"postalCode": "10021-3100"
},
"children": [ ],
"spouse": null
}
Austauschformate - XML (Extensible Markup Language)¶
Markup-Sprachen erlauben es Teile eines Textes zu markieren, um weitere (meist maschinenlesbare) Informationen und Semantik hinzuzufügen
XML ist dabei eine Meta-Sprache, die es erlaubt solche Sprachen zu definieren
Markup geschieht hier durch öffnende und schließende Tags, die mit
<und>eingeklammert werdenBeispiele für XML-nahe Sprachen:
- HTML
- XHR (XML HTTP Request)
- GML
<person>
<name> John </name>
<isAlive> true </isAlive>
<age> 25 </age>
<address>
<cityStreet> New York, 21 2nd Street </cityStreet>
<postalCode> 10021-3100 </postalCode>
</address>
<children> </children>
<spouse> </spouse>
</person>
Austauschformate - CSV (Comma Separated Values)¶
Textuelle Darstellung von strukturierten Daten (Tabellen, Listen usw.)
Tabellenzeilen sind Zeilen und Spalten, diese sind durch Begrenzungszeichen angeordnet
Begrenzungszeichen können Semikolon, Komma, Tabulator usw. sein
FirstName;LastName;IsAlive;Age
John;Smith;true;25
Mary;Sue;true;30
Lesson Learned¶

Lesson Learned - Zielesetzung¶
- Spezifisch: Ziel leicht verständlich und mit nur zwei Sätzen genau beschreiben.
- Messbar: Die Zielerreichung ist quantitativ oder qualitativ feststellbar.
- Attraktiv: Die Erreichung des Zieles ist für EUCH erstrebenswert (ich-Bezug).
- Realistisch: Das Ziel ist ambitioniert und erreichbar.
- Terminiert: Konkreten Termin bis wann das Ziel erreicht werden soll.
fragen?
und datenbanken